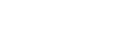Totholz
Totholz ist ein wichtiger Bestandteil der Tieflandfließgewässer, der die Morphologie, die Ökologie und die Eigendynamik des Gewässers beeinflusst. Holz in Fließgewässern bietet Lebensraum und Zufluchtsorte für Fische und wirbellose Tiere und ist ein Ort der Biofilmproduktion, der als Nahrung für Weideorganismen dient.
©vision-wasser.de
Laufveränderung durch Totholz an der Kanalstraße der Münsterschen Aa
Kleine Maßnahme, Maßnahme ohne Eingriff in den Gewässerverlauf bis hin zu einer großen Maßnahme
Durchführung
Totholz kann sowohl durch Gewässerunterhaltung und den natürlichen Eintrag in das Gewässer oder aber im Umfang eines Gewässerausbaus eingebracht werden. Im Folgenden sollen die verschiedenen Varianten dargestellt und erläutert werden.
Im Gewässer unterliegt Holz einer natürlichen Dynamik von Anlagerung, Abbau, Eintrag und Transport. Der natürliche Eintrag von Gehölz in ein Gewässer bietet hohes Besiedlungspotenzial durch Makrozoobenthos und sollte daher dem Einbau von Stammholz, durch den die natürliche Holzzusammensetzung nicht nachempfunden werden kann, vorgezogen werden (Lester et al. 2009, Mutz et al. 2001). Die Voraussetzung für einen natürlichen Eintrag von Totholz sind Uferrandsteifen oder ein Gehölzsaum. Zur Förderung der Ufergehölze finden Sie weitere Informationen unter →Gehölzsaum. Im Rahmen der Gehölzpflege kann die Entnahme von Gehölzen nur an Standorten mit Hochwassergefährdung und anderen Restriktionen durchgeführt werden. Der natürliche Eintrag von Holz ermöglicht darüber hinaus auch eine Verdriftung in unterhalb liegende, gehölzfreie Gewässerabschnitte. Diese natürliche Verlagerung sollte auch aufgrund der hohen Bedeutung von Driftholz für viele Organismen nach Möglichkeit nicht unterbunden werden. Potenziell gefährliches Holz muss im Rahmen der Gewässerunterhaltung entnommen werden. Dabei sollte das Ziel überwiegend die Vermeidung von Dammbildung und Verklausungen sein, die eine Gefahrenquelle darstellen können (Seidel, 2017).
Der Einbau von Holz in Fließgewässer ist vor allem als Übergangs- und Initialmaßnahme zur Strukturanreicherung sinnvoll. Wenn die Eintragspfade von Holz fehlen, ist daher der Einbau von Totholz oft sinnvoll, um die Zeit bis zum natürlichen Eintrag zu überbrücken. Weiterhin sollte aber der natürliche Eintrag gefördert werden, um langfristige Verbesserungen durch Maßnahmen mit Totholz zu erreichen (Osei et al. 2015).
Ähnliche Maßnahmen
Geeignet für die Umsetzung von
Totholz im Rahmen einer kleinen Maßnahme
Nutzen
Der Einbau von Holz kann dazu führen, dass sich weiteres Driftholz anlagert. Dadurch kann eine natürliche leitbildkonforme Zusammensetzung des Gehölzes im Gewässer entstehen. Besonders die steigende Oberfläche, die einen Lebensraum für das Makrozoobenthos bietet, kann zur Verbesserung der Zusammensetzung der aquatischen Wirbellosen führen. Beispielsweise führte das Vorkommen von Holz in einem naturnahen sandgeprägten Bach in Schleswig-Holstein zu einer höheren Artenanzahl von Ephemeroptera, Plecoptera und Trichoptera auf Holz im Vergleich zu Sand (Speth & Böttger, 1993). Ausgiebige Untersuchungen von verschiedenen Tieflandbächen in Brandenburg konnten ebenfalls zeigen, dass Totholz die Gewässerbewertung des Makrozoobenthos verbessern kann. Eine solche Zustandsverbesserung konnte jedoch insbesondere bei Fließgewässern mit einer moderaten Belastung (einem mindestens “mäßigen” ökologischen Zustand) erreicht werden. Totholz in stark belasteten Gewässern führt hingegen nur zu einer Minderung der Wirkung von vielen Stressoren (Seidel 2017). Bei der Verbesserung des Artenreichtums durch Totholz sollte daher das Strahlwirkungskonzept mitgedacht werden.
Abgesehen von dem Lebensraum für Makrozoobenthos kann der Einbau oder die natürliche Entwicklung von Totholz auch zur Bildung von Kolken und Unterständen führen und Furten können stabilisiert werden. Diese bieten einen wichtigen Lebensraum für viele Fischleitarten. Besonders das Vorkommen von Hasel, Erlitze, Gründling und Forelle ist mit Kolken im Gewässer assoziiert. Furte fördern das Besiedlungspotenzial für Groppen und Schmerlen sowie juvenilen Forellen (Osei et al. 2015).
Entwicklungsziele bei hohen Restriktionen
Bei hohen Restriktionen kann der Einbau von Holz nur so erfolgen, dass dieses nicht zur eigendynamischen Entwicklung und damit zur Veränderung der Uferbereiche führt. Dadurch können unter solchen Bedingungen nur Mikrohabitate geschaffen werden, die überwiegend Habitate für das Makrozoobenthos bieten. Solche Habitate können lagestabile Hartsubstrate sein. Fische hingegen reagieren vor allem auf Folgestrukturen des Holzes (Osei et al. 2015), die aber in Abschnitten mit hohen Restriktionen nicht gebildet werden. Für Fische sind daher nur leicht verbesserte Laichbedingungen zu erwarten.
Weiterführende Informationen
Ein ausführlicherer Einblick in die Auswirkungen von Totholz und die passgenaue Umsetzung für eine Verbesserung der Bewertung durch die WRRL können der Dissertation “Naturnaher Einsatz von Holz zur Entwicklung von Fließgewässern im Norddeutschen Tiefland” entnommen werden.
Literatur
Johnson, L. B.; Breneman, D. H.; Richards, C. (2003). Macroinvertebrate community structure and function associated with large wood in low gradient streams. In: River Res. Applic. 19 (3), S. 199–218. DOI: 10.1002/rra.712.
Lester, R. E., & Wright, W. (2009). Reintroducing wood to streams in agricultural landscapes: changes in velocity profile, stage and erosion rates. River Research and Applications, 25(4), 376-392. https://doi.org/10.1002/rra.1158.
Osei, N. A.; Harvey, G. L.; Gurnell, A. M. (2015). The early impact of large wood introduction on the morphology and sediment characteristics of a lowland river. In: Limnologica – Ecology and Management of Inland Waters 54, S. 33–43. DOI: 10.1016/j.limno.2015.08.001.
Seidel, M. (2017). Naturnaher Einsatz von Holz zur Entwicklung von Fließgewässern im Norddeutschen Tiefland. BTU Cottbus-Senftenberg. https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/docId/4431.
©EUfMAa 2022