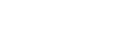Naturnahe Linineführung
Fließgewässer unterliegen einer starken Dynamik aus Abtragung, Transport und Sedimentation, welche besonders im Tiefland zu mäandrierenden Fließgewässern führt. Eine naturnahe Linienführung schafft verschiedene natürliche Mikrohabitate und kann damit zur Verbesserung der ökologischen Komponente beitragen (Umweltbundesamt 2014).
Große Maßnahme
Durchführung
Natürliche Tieflandbäche zeichnen sich durch eine stark mäandrierende Form aus. Zur Wiederherstellung der naturnahen Linienführung zählen verschiedene Maßnahmen, darunter die Wiederherstellung einzelner Fluss- oder Mäanderbögen oder die Neutrassierung längerer Gewässerabschnitte mit gewundener bis mäandrierender Linienführung. Die Umsetzung dieser Maßnahmen scheitert jedoch häufig an der Verfügbarkeit der benötigten Flächen entlang des Gewässers. Das Initiieren und das Neutrassieren einer naturnahen Linienführung sind Renaturierungsmaßnahmen, die Bereiche der Aue einschließen und die für die fortlaufende eigendynamische Entwicklung nach Abschluss der Maßnahmenumsetzungen grundsätzlich Gewässerrandstreifen bzw. typgemäßer Entwicklungskorridore benötigen, weshalb eine hohe Flächenverfügbarkeit gegeben sein muss (MUNLV NRW 2010).
Die Neutrassierung eines Gewässerabschnittes ist dann notwendig, wenn nicht genügend Fließdynamik und Geschiebetransport im Gewässer besteht, um sich eigendynamisch zu entwickeln und damit das Initiieren der Entwicklung nicht ausreichend ist. Durch die Neutrassierung können Altgewässer der Aue wieder an das Gewässer angebunden und typgerechte Gefälleverhältnisse wieder hergestellt werden, wodurch wichtige Lebensräume für die gewässertypischen Leitarten entstehen (Umweltbundesamt o.A.; MUNLV NRW 2010). Ziel ist es, einen möglichst gewässertypischen Verlauf zu gestalten und detaillierte Strukturelemente der eigendynamischen Entwicklung zu überlassen und damit auf die Feingestaltung zu verzichten. Insgesamt wird somit die Besiedlung durch naturnahe Fauna und Flora gewährleistet. Darüber hinaus sollte bei der Planung der neuen Trasse das Relief, die Bodenverhältnisse und die Restriktionen berücksichtigt werden (MUNLV NRW 2010).
Bei der Neutrassierung können außerdem wichtige Strukturelemente wie beispielsweise Totholz und Tiefenrinnen in den Gewässerabschnitt eingebaut und die Sohle neu gestaltet werden.
Ähnliche Maßnahmen
Geeignet für die Umsetzung von
Nutzen
Wird in Tieflandbächen die naturnahe Linienführung wieder hergestellt, hat dies Auswirkungen auf die Hydromorphologie des Gewässers. Mäandrierende Abschnitte sind in der Regel breiter und weisen eine größere Anzahl Gerinneelemente und Substrate auf. Es können Nebengerinne, Seitenriegel, Inseln und weitere Strukturen entstehen, die zu verschiedenen Substrattypen führen können. Eine Untersuchung zweier Tieflandbäche in NRW zeigte, dass restaurierte Gewässerabschnitte zusätzliche Substrate wie Totholz, Lehm und Kies aufwiesen, während in begradigten Abschnitten Sand dominierte. Es konnte außerdem festgestellt werden, dass renaturierte Abschnitte durch die Mäander eine hohe Variation von Tiefe und Strömungsgeschwindigkeit haben (Lorenz et al. 2009). Generell besiedelt Makrozoobenthos in Flüssen ein breites Spektrum an Substratgrößen und hydraulischen Bedingungen. Eine naturnahe Linienführung stellt viele Habitate zur Besiedlung zur Verfügung. Die untersuchten Tieflandbäche Schwalm und Gantroper Mühlenbach zeigten beispielsweise eine Zunahme verschiedener Trichoptera– und Coleopteraarten (Lorenz et al. 2009).
Mäander können auch Habitate für einige Fischleitarten darstellen. Jungfische und Larven von Rotaugen und Steinbeißern besiedeln Mäander. Darüber hinaus bieten Prallhänge Mesohabitate für die junge also auch adulte Bachforellen, Äschen und Groppen (flussgebiete.nrw o.A.).
Der Erfolg einer Renaturierungsmaßnahme hängt sowohl von den daraus resultierenden Habitaten ab, als auch von dem Wiederbesiedlungspotenzial des gesamten Fließgewässersystems. Das Vorhandensein von naturnahen und ungestörten Standorten ist essenziell, denn diese sind Hotspots für die Wiederbesiedlung (Spänhoff und Arle 2007).
Leitarten, die von der Maßnahme profitieren
- Trichoptera
- Coleoptera
- Rotauge
- Steinbeißer
- Forelle
- Groppe
Literatur
Flussgebiete.nrw (o.A.). Anhang IV. 3: Habitatansprüche der Fischarten (Teil1). https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/anhang_iv.3_habitatansprueche_fische_teil1.pdf
Lorenz, A. W., Jähnig, S. C., & Hering, D. (2009). Re-meandering German lowland streams: qualitative and quantitative effects of restoration measures on hydromorphology and macroinvertebrates. Environmental management, 44(4), 745-754.
Lorenz, S., & Wolter, C. (2019). Quantitative response of riverine benthic invertebrates to sediment grain size and shear stress. Hydrobiologia, 834(1), 47-61.
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (2010). Blaue Richtlinie. Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässer in Nordrhein.Westfalen. Düsseldorf.
Spänhoff, B., & Arle, J. (2007). Setting attainable goals of stream habitat restoration from a macroinvertebrate view. Restoration Ecology, 15(2), 317-320. https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.2007.00216.x.
Umweltbundesamt (2014). Hydromorphologische Steckbriefe der deutschen Fließgewässertypen. Anhang 1 von “Strategien zur Optimierung von Fließgewässer-Renaturierungsmaßnahmen und ihrer Erfolgskontrolle”.
Umweltbundesamt (o.A.). Renaturierung von Fließgewässern. Renaturierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes. https://www.umweltbundesamt.de/renaturierungsmassnahmen-zur-verbesserung-des?parent=74909#massnahmentypen.
©EUfMAa 2022