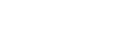Auengewässer
„Auen übernehmen eine bemerkenswerte Vielfalt wichtiger Funktionen für die Gesellschaft“ – BMUV 2015
Durch die intensive Nutzung der Flüsse und Flussauen befinden sich viele Gewässer nicht in ihrer typischen morphologischen Gestalt. Die Gebiete ehemaliger Auen zeichnen sich heute vor allem durch intensive Landwirtschaft, Siedlungen und Verkehrsinfrastruktur aus. In diesen Gebieten ist daher die Wiederherstellung von Auenlandschaften durch den schwierigen Erwerb von Land herausfordernd.
©vision-wasser.de
Renaturierung an Haus Kump
Große Maßnahme; hoher Flächenbedarf
Durchführung
Ist ein ausreichend großer Entwicklungskorridor vorhanden, sollte die natürliche Entwicklung einer Aue gefördert oder eine Aue künstlich hergestellt werden. Die natürliche Entwicklung von Primärauen kann durch das Entfernen von Uferverbau, das Einbringen von Totholz, das Anbinden abgetrennter Altarme und Flutrinnen, die Anhebung der Gewässersohle sowie durch den Rückbau von Dämmen aktiviert werden. Zudem können Initialpflanzungen die Entwicklung einer leitbildkonformen Ufervegetation unterstützen. Muss jedoch die Gewässersohle eingetieft bleiben, um einen ausreichenden Abfluss zu sichern, kann alternativ eine Sekundäraue entwickelt werden. Sekundärauen sind tiefer liegende Überschwemmungs- und Entwicklungsflächen, die typische hydromorphologische Strukturen übernehmen können. Durch Primär- und/oder Sekundärauen kann nicht nur der Fluss als Lebensraum aufgewertet werden, die Auenlandschaft trägt auch zum Hochwasserschutz bei (Umweltbundesamt 2008). Durch die Renaturierungsmaßnahmen können naturnahe Gewässerufer, auentypische Feuchtgebiete und Stillgewässer, Feuchtwiesen und Weich- und Hartholzauwälder entstehen (BMUV 2015). Die bauliche Anlage einer Aue gilt als Gewässerausbau und umfasst eine wesentliche Umgestaltung des Gewässers und seiner Ufer. Die Initiierung einer eigendynamischen Entwicklung kann hingegen auch im Rahmen der Gewässerunterhaltung durchgeführt werden (Umweltbundesamt 2008).
Ähnliche Maßnahmen
Inkludierte Maßnahmen für die Umsetzung
Nutzen
Auengewässer sind nicht nur für den Hochwasserschutz von großer Bedeutung, sondern stellen auch einen Lebensraum für verschiedene Fischarten und aquatische Wirbellose dar.
Auengewässer sind wichtige Laich-, Aufzucht- und Rückzugsgebiete für viele Fischgemeinschaften und somit für den Erhalt der Fischpopulationen von großer Bedeutung (Bolland et al. 2012). Auengewässer können unterschiedliche Charakteristika haben. Es kann sich um fließende Nebengewässer, einseitig angebundene Altarme, vom Fließgewässer abgetrennte Altwasser oder aber stark verlandete Altwasser handeln (Amoros et al. 1987). Die Verbundenheit mit dem Hauptgerinne ist eine treibende Kraft für die verschiedenen Artengemeinschaften, die den Lebensraum nutzen (Manfrin et al. 2020). Für viele Fischarten sind stehende Altarme essenzielle Reproduktionsbiotope. Zu diesen Auenarten gehören beispielsweise Bitterling, Giebel, Karausche, Rotfedern oder Schleie. Dies sind keine Fischleitarten für sandgeprägte Tieflandbäche, tragen aber dennoch zu einer größeren Biodiversität bei. Zudem sind einige Arten in der Lage, sowohl in fließenden als auch in stehenden Gewässern zu laichen und profitieren von Flussauen. Dazu gehören Barsch, Gründling, Dreistachliger Stichling, Quappe, Rotauge, Steinbeißer und Ukelei (Schwevers 2012; Flussgebiete.nrw o.A.).
Leitarten, die von der Maßnahme profitieren
Flussauengewässer werden außerdem durch verschiedene aquatische Wirbellose besiedelt. Die Verbesserung der Artzusammensetzung hängt jedoch stark mit dem Wiederbesiedlungspotenzial des Gewässerabschnittes zusammen und kann daher nicht genau vorhergesagt werden. Jedoch ist anzunehmen, dass sich herkömmliche Flussmakrozoobenthos ansiedeln. Beispielsweise besiedelten einige Jahre nach der Herstellung einer Auenlandschaft an der Donau Eintagsfliegenlarven (Baetis sp.), Köcherfliegenlarven (Hydropsychidae sp.) und einige Plecopteraarten die Flussauen (Pander et al. 2018). Die Variabilität der Artgemeinschaften und deren Habitatansprüchen zeigt nicht nur die Bedeutung der Auengewässer allgemein, sondern auch die Bedeutung der funktionalen Vielfalt der Aue insgesamt (Manfrin et al. 2020).
Die Besiedlung verschiedener Lebensgemeinschaften weist darauf hin, dass bei der Wiederherstellung von Auenlebensräumen nicht nur die Wiederherstellung einer maximalen Vernetzung berücksichtigt werden sollte, sondern ein Mosaik verschiedener Lebensraumtypen mit unterschiedlichem Grad an Vernetzung und Störung hergestellt werden sollte. Die verschiedenen Lebensraumtypen einer Aue beherbergen einzigartige Artenzusammensetzung, sodass solche Lebensraummosaike außergewöhnlich vielfältige Ökosysteme ermöglichen können.
Weiterführende Literatur
Eine detaillierte, exemplarische Erfolgskontrolle zu Auenrenaturierungen an der Hase, Berkel, Oster und Oberwasser finden die hier:
Literatur
Amoros, C., Roux, A. L., Reygrobellet, J. L., Bravard, J. P., & Pautou, G. (1987). A method for applied ecological studies of fluvial hydrosystems. Regulated Rivers: Research & Management, 1(1), 17-36. https://doi.org/10.1002/rrr.3450010104
Bolland, J., Nunn, A., Lucas, M., Cowx, I., (2012). The importance of variable lateral connectivity between artificial floodplain waterbodies and river channels. River Res. Appl. 28, 1189–1199. https://doi.org/10.1002/rra.1498
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015). Den Flüssen mehr Raum geben. Renaturierung von Auen in Deutschland. https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/auen_in_deutschland_bf.pdf
Flussgebiete.nrw (o.A.). Anhang IV. 3: Habitatansprüche der Fischarten (Teil1). https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/anhang_iv.3_habitatansprueche_fische_teil1.pdf
Manfrin, A., Bunzel-Drüke, M., Lorenz, A. W., Maire, A., Scharf, M., Zimball, O., & Stoll, S. (2020). The effect of lateral connectedness on the taxonomic and functional structure of fish communities in a lowland river floodplain. Science of the Total Environment, 719, 137169. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137169
Pander, J., Mueller, M., & Geist, J. (2018). Habitat diversity and connectivity govern the conservation value of restored aquatic floodplain habitats. Biological Conservation, 217, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.10.024
Schwevers, U. (2012). Strukturelle Anforderungen der Fischfauna an Auengewässer. Artenschutzreport Heft 29 (2012) 29-38. https://www.researchgate.net/profile/Ulrich-Schwevers/publication/351110523_Strukturelle_Anforderungen_der_Fischfauna_an_Auengewasser/links/60880d2f881fa114b42f44f2/Strukturelle-Anforderungen-der-Fischfauna-an-Auengewaesser.pdf
Umweltbundesamt (2008). Kleine Fliessgewässer pflegen und entwickeln: neue Wege bei der Gewässerunterhaltung. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3747.pdf
©EUfMAa 2022