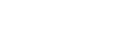Döbel
Döbel besiedeln mittelgroße Bäche bis große Flüsse und kommen an Riffel-Pool-Strukturen, aber auch im tieferen Uferbereich langsam fließender Tieflandgewässer und Altarmen vor (Schabuss & Reckendorfer 2006). Döbel reagieren sensibel auf Verschmutzungen und können daher ein Indikator für sauberes Wasser sein.
Habitatansprüche
Döbel wandern zum Laichen in rascher fließenden Gewässerabschnitten mit sandig-kiesigem Substrat und legen ihre Eier an Steine oder zwischen submersen Makrophyten (Schneider & Korte 2005; Dumont et al. 2005). In der Laichzeit bieten Kolke in den Laichhabitaten wichtige Ruhe- und Sammelplätze.
Die Larven der Döbel leben an sonnenexponierten, strömungsfreien Habitaten und nutzen auch Altarme oder durchströmte Seen als Habitat. Die Larven bevorzugen verschlammten Kies mit Makrophyten, Totholz und Beschattung (Copp et al. 2010). Auch die Juvenile nutzen strömungsarme und schlammig/sandige Gewässerbereiche mit Makrophyten und/oder Steinbuchten als Lebensraum. Diese Habitate finden sie sowohl in strömungsberuhigten Gewässerbereichen als auch in semipermanenten sowie temporären Altarmen (Juraida 1999; Schabuss & Reckendorfer 2006).
Die Verbreitung der ausgewachsenen Döbel ist überwiegend durch die Substratbeschaffenheit bestimmt. Zudem mögen Döbel überdachte Bereiche vor Brücken und Wehranlagen oder unter Ansammlungen von Totholz und Ufervegetation (Schneider & Korte 2005). Sie bevorzugen Gewässerabschnitte mit erodierten Ufern und Totholz sowie schlammiges Substrat, während felsige Stellen und kiesiges Substrat an schnell fließenden Abschnitten gemieden werden. Zudem besiedeln Döbel überwiegend tiefere Abschnitte mit Deckungsmöglichkeiten und vermeiden flache Uferbereiche (Pavel et al. 2005; Pandler & Geist 2010). Mit zunehmender Größe halten sich Döbel in stärker strömenden Bereichen auf.
Geeignete Maßnahmen
Maßnahmenimplikationen
Querbauwerke beeinflussen besonders Wanderfische, da die Wanderung in die Laichhabitate eingeschränkt ist, wodurch es zur Reduzierung der Bestände kommt. Daher sollte die Durchwanderbarkeit des Gewässers zu den Laichhabitaten priorisiert werden. Um die Abundanzen von Döbeln im Gewässer zu fördern, müssen durch Kiesrauschen und Kolke geeignete Laichhabitate geschaffen werden. Das Vorkommen von Makrophyten und Totholz kann den Jungfischen Schutz vor Fressfeinden bieten, daher sollte der natürliche Eintrag von Totholz durch einen Gehölzsaum gefördert werden. Da Döbel sensibel auf Gewässerverschmutzungen reagieren, sollte vor der Renaturierung festgestellt werden, ob die Verbesserung der Wasserqualität priorisiert werden muss, damit der Gewässerabschnitt von dem Döbel besiedelt werden kann.
Literatur
Dumont, U., Anderer, P., & Schwevers, U. (2005). Handbuch querbauwerke. Düsseldorf (Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und ländlichen Raum NRW).
Jurajda, P. (1999).Comparative nursery habitat use by 0+ fish in a modified lowland river. Regulated rivers: Research & Management 15, 113-124.
Pander, J. & Geist, J. (2010). Seasonal and spatial bank habitat use by fish in hihgly altered rivers – a comparison of four different restoration measures. Ecology of Freshwater Fish, 19, 127-138.
Pavel, V., Dusek, J., Svatora, M. & P. Moravec (2005). Fish assemblage structure, habitat and microhabitat preference of five fish species in a small stream. Folia Zoologica 54 (4), 421-431.
Schabuss, M. & Reckendorfer, W. (2006). Die Hydrologie als Schlüsselparameter für die Verteilung der Adult- und Jungfischfauna im Altarmsystem der Unteren Lobau. Wissenschaftliche Reihe Nationalpark Donau-Auen, 12.
Schneider, J. & E. Korte (2005). Strukturelle Verbesserungen von Fließgewässern für Fische. Empfehlungen für die Lebensraumentwicklung zur Erreichung eines guten ökologischen Zustands gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie. – Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung (GFG) mbH, Hrsg., Mainz.
©Schmidt 2022